Vortrag zum Gedenken
an den Prager Frühling in Liberec
 |
|

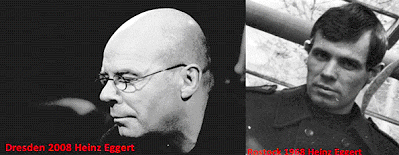
 |
|

Wenn sich die Deutsche Einheit am 20.08.1968 vollzogen hätte, wäre ich trotz meiner Jugend (22 Jahre) bereits eine politische „Altlast“ gewesen:
Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und wuchs mit einem Stiefvater auf. Wir wohnten in Rostock. Meine Eltern waren nicht sehr staatskritisch. Politische Meinungen wurden nur geflüstert, wenn die Kinder das Zimmer verlassen hatten. Bei allen staatlich verordneten Aufmärschen waren sie dabei. Die Arbeitskollegen gingen ja auch alle. Den einzigen politischen Konflikt, den ich mitbekommen habe, gab es 1953: Meine Mutter schloss meinen Stiefvater ein, damit er nicht zur Neptun-Werft demonstrieren gehen konnte, weil die Russen dort auf die Werftarbeiter schossen. Ihre Begründung: „Du bist nicht gesund aus dem Krieg gekommen, damit sie dich jetzt erschießen.“
Ich war selbstverständlich in den Jungen Pionieren, folgerichtig in der FDJ, der GST – „Gesellschaft, Sport und Technik“, im FDGB – "Freier Deutscher Gewerkschaftsbund" und in der DSF „Deutsch-Sowjetische Freundschaft“. Überall bin ich folgerichtig und unkritisch hineingeboren worden. Es war wie bei den Meisten – sobald man das Alter hatte, unterschrieb man und war Mitglied in diesen Organisationen. Dieser Mechanismus schützte auch vor kritischen Fragen oder kritischem Nachdenken. Außerdem gab es für alle auch nur ansatzweise kritischen Nachfragen das globale alles erschlagende Argument: „Bist du für den Frieden oder bist du für den Krieg?“ – Natürlich für den Frieden. Aber der Garant für den Frieden, das wussten wir alle, war nur das kommunistische System.
Schön, wenn die Welt so einfach begreifbar gemacht wird.
Aus der 8. Klasse war ich wegen Schulschwänzens geflogen. Nachdem ich mit 15 Jahren ein Jahr auf dem Bau gearbeitet hatte, konnte ich eine Lehre bei der DR beginnen, war bald bester Lehrling, und auf Grund des Jugendförderungsplans der FDJ mit 18 Jahren der jüngste Stellwerksmeister der DDR auf dem Bahnhof Warnemünde. Dann wurde ich Fahrdienstleiter und nutze meine Freifahrscheine auch, um nach Prag zufahren. Damals war ich 21 Jahre. In diese Stadt und in Marta habe ich mich damals verliebt. Ein tiefer emotionaler Bezug. Die Liebe öffnet ja immer die Augen.
Die heißen politischen Auseinandersetzungen über einen reformierten demokratischen Sozialismus habe ich intellektuell damals nicht verstanden. Da die Diskussionen vor allem von Studenten und Schriftstellern ausgingen, ging das auch vielen meiner damaligen tschechischen Freunde so. Liberalisierung, Pressefreiheit, Pluralismus, Freiheit der Gewerkschaften, Streikrecht, Versammlungsrecht, Aufhebung der Zensur, Reisefreiheit – das las ich in politischen Zeitungen, auch auf Deutsch. Aber es bewegte mich nicht besonders, denn erstens hatte ich es noch nie vermisst, und zweitens war ich erstaunt, dass es im Sozialismus so viele Probleme geben sollte. Aber da niemand den Sozialismus abschaffen wollte – zumindest erklärte das keiner – sondern ihm ein menschlicheres Antlitz verpassen, das gefiel mir schon sehr.
Prag war damals im Aufblühen innerhalb der sozialistischen Staaten. Es war eine heitere, offene Atmosphäre. Das Leben war bunter und verbannte die Langeweile aus dem Alltag. Ich konnte Musik hören, die in der DDR noch die Musik des Klassenfeindes war, Beatles-Filme sehen, Bücher kaufen, die es in der DDR nicht gab. Es war insgesamt eine lockere, leichte und lebenslustige Atmosphäre des Sozialismus, wie ich sie aus der DDR nicht kannte.
Abends saßen wir in der Schwarzbierkneipe „U Fleku“ mit jungen Österreichern, Westdeutschen, Italienern, Engländern und Amerikanern zusammen – alles Länder, aus denen ich noch nie jemanden kennen gelernt hatte – die so lebenslustig feierten, dass man ihnen die Probleme des Kapitalismus nicht gleich ansah. Wir waren jung, und die Welt schien offen. Obgleich ich wusste, dass ich ihre vielen Einladungen nicht annehmen konnte, obwohl ich mit meinen Eisenbahnfreifahrscheinen umsonst gefahren wäre. Der Gedanke an Reisefreiheit wurde langsam verführerisch.
Es sind wohl die selbst empfundenen Defizite, die sich in unserer politischen Überzeugung langsam, aber sicher niederschlagen. In Prag war alles von einem Hauch von Freiheit umweht.
Langsam begann ich in der DDR die reglementierte Strenge des von Moskau diktierten Sozialismus zu hinterfragen. Deshalb, immer wenn es meine freie Zeit zuließ, war ich in Prag. Wegen der Stadt, wegen Marta und der freien Atmosphäre. An der Grenze gut kontrolliert, besonders nach Zeitschriften und Tonbändern untersucht, kam ich dann wieder in meiner sozialistischen Heimat an.
In der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 hatte ich in Warnemünde auf dem Stellwerk Dienst. Es war eine laue Sommernacht bei ruhiger See. Zur gleichen Zeit, als ich gegen 23:00 Uhr den Rangierbetrieb mit dem dänischen Fährschiff „Kong Frederik“ beaufsichtigte, sendeten in Prag drei sowjetische Militärtransporter einen Notruf an den zivilen Flughafen in Prag. Sie baten um Landeerlaubnis, die abgelehnt wurde, da sich ganz in der Nähe ein militärischer Flughafen befand. Die Flieger landeten somit ohne Genehmigung auf dem Flughafen. An Bord waren sowjetische Fallschirmjäger, die sofort begannen, den Flughafen zu sperren. Nachdem der Flughafen unter deren Kontrolle war, landeten im Minutentakt russische Truppentransporter und luden Panzer und Geschütze aus.
In dieser Nacht sind die Russen und ihre Verbündeten aus Polen, Bulgarien und Ungarn in die Tschechoslowakei einmarschiert. Die Polen marschierten auf dem Landweg über Hradec Králové ein. Sie waren schon lange vorher an den Grenzen stationiert worden, um angeblich ein Manöver gegen die NATO vorzubereiten. Nur die Truppen der DDR-NVA durften trotz der Bitten des damaligen Staatsratsvorsitzenden Ulbricht an Breschnew nicht am Einmarsch teilnehmen. Die sowjetische Führung hatte auf den Einsatz der NVA-Einheiten verzichtet, weil tschechoslowakische Funktionäre zuvor darum gebeten hatten. Der Einsatz deutscher Soldaten 30 Jahre nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch die Wehrmacht wurde als gefährliche Provokation empfunden. Nicht schon wieder deutsches Militär in Prag!
Aber diese Zusammenhänge kannte ich damals noch nicht. Woher auch, sie waren nicht bekannt. Fassungslos hörte ich die Nachtnachrichten des verbotenen NDR auf dem im Dienst verbotenen Radio, die auch die Hilferufe der tschechischen Opposition weiter verbreiteten. Von Toten und Verletzten und Widerstand war die Rede. Es war Krieg im Sozialismus. Sozialisten gegen Sozialisten. Meine selbstverständlichen sozialistischen Überzeugungen bröckelten In dieser Nacht ab. Der Funkturm auf dem Jeschken bei Liberec war übrigens der letzte, der von den Okkupanten abgeschaltet worden war. Ich sehe ihn jetzt jeden Tag von Zittauer Gebirge aus. In dieser Nacht begriff ich, dass ich zwar noch jung war, die Welt aber nicht mehr offen.
Um 6:00 Uhr morgens war meine Schicht zu Ende. Beinahe zeitgleich war die Staatskanzlei von Alexander Dubček, der politischen Leitfigur des Prager Frühlings, von russischen Fallschirmjägern besetzt worden. Sie hatten den Auftrag, ihn nach Moskau zu bringen. Dort wurde er ins Gefängnis gesteckt. Vorher gelang es ihm noch seinem Bürochef, eine Tasche mit Dokumenten zu übergeben, die den Russen nicht in die Hände fallen sollten. Er wusste nicht, dass der schon lange für den KGB arbeitete. Wie menschlich der Sozialismus geworden war, kann man an der Tatsache ablesen, dass Dubček nicht erschossen wurde, sondern sein Lebensunterhalt als Waldarbeiter verdienen durfte. Das wurde im politischen Westen schon als Zeichen der Entspannung gesehen. Aber auch das wusste ich selbstverständlich in dieser Nacht noch nicht.
Nach der Schicht wurde eine Versammlung vom SED-Parteisekretär einberufen. Alle mussten daran teilnehmen. Dann sollten wir – wie es in der DDR üblich war – gleich unterschreiben, dass wir den Einmarsch für richtig hielten, da er der Rettung des Friedens diente. Mir fiel ein Satz ein, dem ich im tschechischen Auslandsjournal „Im Herzen Europas“ gelesen hatte: „Der Mensch hat nicht solange sprechen gelernt, um sich dann das Sprechen verbieten zu lassen.“ (Prochazka) Ich habe mich damals als Einziger geweigert zu unterschreiben.
Zwei Tage später fand bei mir eine Hausdurchsuchung statt. Meine über die Jahre dann sehr angeschwollene Stasiakte bekam ihr erstes Blatt. Ich trat als Protest aus allen Organisationen aus. Es war aber schwierig, in der DDR aus Organisationen auszutreten, denn eines gab es nicht in der DDR: Austrittsformulare. Man sagte mir: „Du stellst halt die Zahlung ein.“ So habe ich die Zahlungen eingestellt und war kein Mitglied mehr. Auf dem Grenzbahnhof durfte ich aus ideologischen Gründen nicht mehr arbeiten. So hat man mich staatlicherseits in eine nicht gewollte, aber überfällige politische Nachdenklichkeit getrieben.
Aber es gab auch zutiefst persönliche Enttäuschungen: Auf einmal rückten Freunde ab. Auch im eigenen Elternhaus verstand keiner meine Entscheidung. Meine Mutter war der Meinung, ich hätte selbst meine berufliche Karriere vernichtet. Womit sie ja Recht hatte.
Ich hatte dann großes Glück: Nachdem Marta in Prag mit ihren Eltern nach Kanada emigriert war, habe ich meine spätere Frau kennen gelernt, die aus einem christlichen Elternhaus kommt. Sie hat mich mit Studenten der evangelischen Studentengemeinde zusammengebracht. Ich habe dann über eine Sonderreifeprüfung – in der ich verschwiegen habe, dass ich keinen Abschluss der 10. Klasse hatte – die Zulassung zum Theologiestudium bekommen. In der Bundesrepublik Deutschland wäre ich niemals Theologe geworden. Der existentielle Anlass hätte gefehlt. Den gab es in der DDR in einer ganz brisanten Weise. Weniger durch die Erleuchtung der Bibel – ich bin auch sehr spät, mit 23 Jahren, konfirmiert worden – sondern eher durch Dietrich Bonhoeffer, und durch Menschen, die aus christlichem Bewusstsein menschlich Diktaturen widerstanden haben. Damit konnte ich wieder leben.
Und so habe ich mich langsam von dieser DDR-Ideologie wegentwickelt, ohne ein Staatsfeind zu sein, den man gerne aus mir machen wollte. Ich hatte noch viel Hoffnung für die DDR und ihr verbesserungsfähiges menschliches Antlitz, weil ich inzwischen die Forderungen des Prager Frühlings verstanden hatte.
Ich bin Pfarrer an der wunderschönen Bergkirche in Oybin, dicht an der tschechischen Grenze. Im März besuchen mich zwei Mitarbeiter des DDR-Fernsehens. Sie wollen Konzerte mit den weltberühmten „Prager Madrigalisten“ aufzeichnen und bitten um die Genehmigung, auch in der Kirche drehen zu dürfen. Den Mut, 1980 in einer Kirche drehen zu wollen, muss ich natürlich unterstützen und sage zu.
So lernte ich den Musikwissenschaftler und Gründer der „Prager Madrigalisten“, Professor Miroslav Venhoda kennen. Ein sehr sympathischer älterer Herr. Meine Frau und ich laden ihn zu uns ein. Er steht abends pünktlich vor der Tür. Unter den einen Arm hat er eine Flasche Wein, unter dem anderen seine Hausschuhe geklemmt. Denn selbstverständlich zieht man seine Straßenschuhe vor der Wohnungstür aus. Wir reden über Gott und die Welt und meine Erlebnisse 1968 in Prag. Er sagt, dass er schon geahnt habe, dass er zu den richtigen Leuten käme.
Dann erzählt er über die Folgen von 1968: Von seinem Schwiegersohn, der als junger Arzt 1968 eine Medizinergewerkschaft gründen wollte, und dann 1970 auf ein kleines böhmisches Dorf verbannt wurde, das er seitdem bei Androhung von Gefängnisstrafe nicht verlassen durfte. Dafür werden alle seine Besucher vom Geheimdienst registriert. Es ist die Stunde der Denunzianten und Emporkömmlinge.
Er erzählt davon, dass die Repressionen selbst vor dem Tod nicht halt machen. Als ein Freund von ihm – ein sehr prominenter tschechischer Wissenschaftler – gestorben war, durfte der Zeitpunkt der Beisetzung in der Todesannonce nicht genannt werden. Er hatte sich 1968 zu sehr politisch engagiert. Damit die Angehörigen nicht seine Freunde und politisch Gleichgesinnten zur Beisetzung einladen konnten, wurde ihnen der Telefonanschluss abgeschaltet. Als der Geheimdienst dann mitbekam, dass die Familienangehörigen es aus Telefonzellen versuchten, bekam die Familie abends nach 20:00 Uhr die Mitteilung, dass aus technischen Gründen die Beisetzung schon morgens um 7:30 Uhr statt 17:00 Uhr nachmittags stattfinden müsste.
Er erzählt von weltbekannten Künstlern und Wissenschaftlern, die nicht mehr auftreten und arbeiten dürfen. Wenn sie eine andere Arbeit suchen, verhindert der Sicherheitsdienst, dass sie welche finden. Sie arbeiten in den städtischen Abwasserkanälen und Müllbetrieben, putzen Fenster oder arbeiten als Heizer und Hausmeister. Ihre Kinder dürfen nicht studieren. Gemeinsam war ihnen, dass ihnen selbst der Zugang zu öffentlichen Bibliotheken versperrt wurde. Oder sie werden auf Dörfer verbannt, die sie nicht verlassen dürfen. Niemand darf über sie schreiben, nirgendwo dürfen sie erwähnt werden – sie sollen totgeschwiegen werden. Deswegen wird über sie nur noch geflüstert.
Er erzählt, wie die Charta 77 – Mitverfasser ist Vaclav Havel – unter der Hand an Freunde weitergereicht wird, und wie die kommunistische Partei medienwirksam im Prager Nationaltheater eine Gegenveranstaltung organisiert hat, an der hunderte tschechische Künstler und Intellektuelle mehr oder minder freiwillig teilgenommen hatten, um eine Anticharta zu verabschieden. Tausende unterschrieben sie in den nächsten Wochen.
Karel Gott versprach dort, mit noch schöneren Melodien ein Beitrag für den Marsch in ein glückliches Leben des Vaterlandes zu leisten. Das alles erzählt Professor Venhoda nicht laut und anklagend, sondern leise und ein wenig ironisch, wie einer, der weiß, dass nichts Bestand in dieser Welt hat. Wir frotzeln noch ein wenig über Karel Gott: Was wäre aus ihm geworden, wenn er sich nicht dem System zur Verfügung gestellt hätte? Venhoda grinst in sich hinein und meint, dass uns dann unersetzliche Gottsche Kunstwerke verloren gegangen wären, weil man dann im Tschechischen nichts mehr von ihm gehört hätte. Und nach einer Weile fügt er ironisch hinzu: Das kann einem den Sozialismus beinahe schon wieder sympathisch machen.
Später erzählt er dann noch vom „Prager Winter“, einer Konzertreihe in Prag: Im Nationaltheater wird die Janáček-Oper „Libuse“ gespielt. Die sagenhafte Gründerin Prags Libuse prophezeit erschütternd: Ihr geliebtes tschechisches Volk werde zwar durch die Hölle müssen, aber es werde nie untergehen. Das klang schon in den Tagen der nationalsozialistischen Besatzung gefährlich. Jetzt kommt bei diesen Worten schütterer Beifall auf. Von den wenigen Tschechen, die Eintrittskarten bekommen haben. Es ist zwar ein nationales tschechisches Festival, aber die Tschechen haben da kaum Zutritt. Es geht nicht nur um Kultur, sondern auch um Devisen. Deshalb sitzen im Zuschauerraum nur Österreicher, Amerikaner und Westdeutsche. Westliches Bildungspublikum eben – das allerdings die Zusammenhänge nicht begreift. Deshalb auch nur schütterer Beifall.
Spät nach Mitternacht geht er wieder in sein Hotel. Das fällt natürlich auf und wird von eifrigen Fernsehleuten an die Staatssicherheit nach Berlin und von dort aus nach Prag weiter gemeldet. Bevor die Dreharbeiten beendet sind, lädt er uns für die Schul-Ferienwoche darauf in sein kleines Bauernhaus in einem böhmischen Dorf ein: 22 Häuser, 16 Milchkannen und eine kleine Kneipe. Gut und intensiv kontrolliert an der Grenze gehen wir abends zusammen nach unserer Ankunft in die Dorfkneipe. Der Wirt begrüßt uns schon vor der Tür und sagt: Sie sind schon da! Professor Venhoda meint, lasst uns über Musik reden, davon verstehen sie nichts. Als wir die Kneipe betreten, sitzen hinten an einem Ecktisch zwei Geheimdienstleute aus Prag. Seltsam, diese Typen sehen überall gleich aus. Wir essen und trinken und reden lange über Musik.
Über diesen Abend habe ich in meinen Akten kein Protokoll gefunden. Offensichtlich war man in den Stasizentralen in Berlin oder Prag an kulturellen Dingen nicht so sehr interessiert.
Leider ist Professor Miroslav Venhoda am 10.5.1987 gestorben. Wir hätten 1989 noch gerne mit ihm im „U Kalicha“ bei unseren Freunden Tomas und Pavel Töpfer darauf angestoßen, dass die Geschichte – Gott sei Dank – keine Sieger kennt. Es hätte Professor Venhoda bestimmt erfreut, dass die Hausmeisterposten 1989 in Prag wieder neu umbesetzt wurden: Einige der Dissidenten, die sie innehatten, wurden zum Minister berufen oder nahmen wieder führende Posten in der Gesellschaft an. Dafür nahmen dann einige aus der alten kommunistischen Parteigarde ihre Plätze als Hausmeister ein. Manchmal könnte man glauben, Gott sei ungeheuer ironisch.
Mit sehr sympathischen, in der Euroregion sehr engagierten jungen Tschechen sitze ich auf dem Marktplatz in Liberec (Reichenberg) vor einem Café. Sie sind alle nach 1970 geboren. 150 m von uns entfernt, an der Vorderfront des herrlichen Rathauses, erinnert eine Gedenktafel mit neun Gliedern einer Panzerkette an die Opfer von 1968. Jedes Glied dieser Panzerkette trägt einen Namen. Gegen 7:45 Uhr eröffnete ein sowjetisches Spezialkommando am 21.8.1968 von einem Schützenpanzerwagen aus das Feuer auf vor dem Rathaus versammelte Demonstranten. Sechs Menschen starben, mehr als 40 wurden verwundet. Gegen Mittag fuhr ein Panzer in ein Haus (gegenüber dem Rathaus) und brachte Teile davon zum Einsturz. Dabei kamen drei Menschen ums Leben.
Trotz dieser Schocks gab es etliche, die mit viel Einfallsreichtum ihren Protest fortsetzen: Sie nutzten Lücken in der Marschkolonne der Sowjetarmee, um an Kreuzungen ohne (sowjetische) Regulierungsposten den Armee-Tross erfolgreich in falsche Richtungen umzuleiten. So fuhren die sowjetischen Schützenpanzerwagen in alle Richtungen, nur nicht nach Prag. Am 23. August waren sämtliche Straßenschilder der Innenstadt ausgetauscht. Jede Straße hieß nun "Dubčeková ulice" (Dubčekstraße). Damit wollten sie den Okkupanten die Orientierung nehmen, andererseits aber auch die Verbundenheit mit Parteichef Dubček zeigen.
Ich rede mit den jungen Tschechen über diese Zeit. Sie wollen unbedingt an dieses Ereignis 1968 erinnern. Aber sie haben ein Problem: Sie finden kaum Zeitzeugen. Die Ereignisse des Prager Frühlings sind bei uns nicht sehr populär, sagt der eine. Und ein anderer ergänzt, es ist er gar nicht so einfach, aus dieser Zeit Helden und Demonstranten von Mitläufern und Angepassten zu unterscheiden. Oftmals würden die Lebensläufe beides hergeben, wenn man neben dem Ereignis 1968 auch das Vorher und Hinterher in den Lebensläufen berücksichtigt. Was wäre zum Beispiel, fragt einer, wenn unter den neun Toten ein Geheimdienstspitzel gewesen wäre, der eigentlich den Auftrag gehabt hätte, die anderen Demonstranten zu bespitzeln, und so zufällig von seinen eigenen Auftraggebern erschossen worden wäre? Wie wäre er einzuordnen? Als Held oder als Denunziant? Ich zitiere den polnischen Schriftsteller Stanislav Lec: Geradlinige, passt in den Kurven auf!
In unseren eigenen Biografien ist doch auch von allem etwas anzutreffen. Heldentum hat man nicht auf Vorrat. Wobei Helden nie besonders beliebt sind, es sei denn, sie treten im Film auf. Im realen Leben führen sie den anderen doch nur ihr Versagen vor und machen ihnen ein schlechtes Gewissen. Wer will das schon aushalten? Aber es gibt zugespitzte geschichtliche Situationen, wo wir, von unseren eigenen Überzeugungen geleitet, instinktiv das Richtige tun. (Was sich hinterher als sehr dumm herausstellen kann, weil es unser Leben und unsere Karriere verändert hat.) Nur das alles setzt voraus, dass man eine Überzeugung hat. Eine Überzeugung, die auf Wertigkeiten basiert.
Vielleicht kann man sich so den geschichtlichen Ereignissen von 1968 am ehesten nähern: Für welche Werte gingen die Demonstranten 1968 auf die Straße, riskierten ihr Leben oder ihre Lebensentwürfe? Und – kann man ohne solche Werte in einer Gesellschaft leben, in der die Mitmenschlichkeit abbröckelt, in der sich Menschen erst unterwerfen müssen, um sich dann zu verkaufen?
Man hat nie alle richtigen Antworten auf alle Fragen parat. Man muss sie sich selbst arbeiten. Manchmal kann man auch die Richtigen fragen. Nur dazu muss man sie ausfindig machen! Selbst auf die Suche gehen! Am dreißigsten Jahrestag der Zerschlagung des Reformprozesses hat es eine Schülergruppe aus der deutschsprachigen Abteilung des Gymnasiums "F. X. Šaldy" in Liberec schon mit Erfolg versucht.
Sehr gerne wird davon gesprochen dass man ein Licht anzünden müsste in der Gesellschaft, damit es heller und wärmer wird.
Am 16.Januar 1969 gab es eine Fackel Nummer Eins:
Zehn Studenten der philosophischen Fakultät in Prag hatten sich zusammengetan,
weil sie philosophisch nicht mehr über das reden durften, was noch vor dem 21. August möglich war.
Ihre Wahrheitssuche war in Gefahr. Es waren gesunde, kluge junge Leute, die niemanden aufnahmen, der psychische Probleme hatte.
Nicht aus Überheblichkeit, sondern aus der Furcht, dass die kommunistische Propaganda sie als Psychopathen
in der Öffentlichkeit darstellen könne.
Sie wollten ein Zeichen setzen. Es wurde gelost.
Die Fackel Nummer Eins hieß Jan Palach. Er war 21 Jahre.
Am 16.1.1969 gegen 15:00 Uhr übergoss er sich am Prager Wenzelsplatz mit Benzin und zündete sich an. Zwei Tage später starb er.
Einige Monate zuvor hatte sich am 8. September 1968 der Pole Ryszard Siwiec in Warschau als Protest gegen den Einmarsch verbrannt.
Die kommunistische Verschweigenstaktik funktionierte so gut, so dass es selbst heute kaum noch jemand weiß.
Auch deshalb muss daran erinnert werden, weil sonst jene gewinnen würden, die die Menschenrechte mit Panzerketten zermalmten und die Menschen mental zu kleinen, verfügbaren Zwergen machen wollten.
Denn das will doch bestimmt keiner von uns sein. Oder?